THEMEN // ISSUES
Moratorium: Rückzug zur Rückkehr
Zeitweisen inneren oder äußeren Rückzug als gesunde Bewältigungsstrategie
In der Psychologie gibt es mehrere Fachausdrücke, die zum Konzept „Rückzug zur Rückkehr“ passen – also zu einem zeitweisen inneren oder äußeren Rückzug, der nicht als Flucht oder Kapitulation zu verstehen ist, sondern als Phase der Neuorientierung, Selbstklärung oder Regeneration. Begriffe wie Moratorium (nach Erik Erikson), Selbstvergewisserung, konstruktiver Rückzug oder Identitätsexploration beschreiben Prozesse, in denen Menschen sich bewusst oder unbewusst vom äußeren Druck entfernen, um später gestärkt, gereift oder klarer ins Leben zurückzukehren.
Moratorium – nach Erik Erikson ein Konzept aus der Entwicklungspsychologie, das eine Auszeit oder Pause beschreibt, in der sich jemand zurückzieht, um die eigene Identität zu erkunden und zu festigen, bevor er wieder aktiv wird.
Regression im Dienste des Ich (Regression in the Service of the Ego) – ein Begriff aus der psychoanalytischen Tradition. Er beschreibt einen bewussten oder unbewussten temporären Rückzug auf frühere Entwicklungsstufen, um sich zu regenerieren und dann gestärkt zurückzukehren.
Katathyme Regression – ein therapeutisches Konzept, bei dem der bewusste Rückzug in innere Bilder und Fantasien genutzt wird, um neue Einsichten zu gewinnen.
Restitution oder Reintegration – Begriffe, die den Prozess beschreiben, wie nach einer Phase des Rückzugs oder der Desorganisation eine neue, oft stabilere Organisation erreicht wird.
In der modernen Psychologie würde man auch von adaptivem Coping oder strategischem Rückzug sprechen – also von einer bewussten Strategie, sich temporär zurückzuziehen, um Ressourcen zu sammeln und dann effektiver zurückzukehren.
Das Konzept findet sich auch in der Resilienzforschung wieder, wo temporärer Rückzug als gesunde Bewältigungsstrategie verstanden wird.
🔹 Moratorium nach Erikson – einfach erklärt:
Definition:
Ein psychosoziales Moratorium ist eine bewusst „aufschiebende Lebensphase“, in der sich junge Menschen von Verpflichtungen (z. B. Beruf, Partnerschaft, feste Identität) bewusst fernhalten, um ihre Identität zu suchen, ausprobieren und entwickeln.
🔹 Kontext: Eriksons Entwicklungsmodell
Erikson beschrieb die menschliche Entwicklung in acht psychosozialen Stufen.
Das Moratorium gehört zur fünften Stufe:
Identität vs. Rollendiffusion
(Jugendalter, ca. 12–20 Jahre)
🔹 Wozu dient das Moratorium?
-
Es schafft Freiraum für Exploration (z. B. Beruf, Beziehungen, Werte).
-
Es ist kein Versagen, sondern ein produktives Innehalten, um sich selbst zu finden.
-
Wer sich zu früh „festlegt“, riskiert eine oberflächliche oder angepasste Identität.
🔹 Beispiele für Moratorium:
-
„Ich mache ein Gap Year und schaue, was ich wirklich will.“
-
„Ich probiere mehrere Jobs aus, bevor ich mich für eine Ausbildung entscheide.“
-
„Ich will noch keine Beziehung, ich muss erst herausfinden, wer ich bin.“
🔹 Abgrenzung zu Selbsteliminierung:
| Begriff | Bedeutung | Wirkung |
|---|---|---|
| Moratorium | Bewusster Aufschub von Festlegung | Explorativ, entwicklungsfördernd |
| Selbsteliminierung | Rückzug aus Handlung, Verantwortung oder Sichtbarkeit | Rückwärtsgewandt, selbstbegrenzend |
🔸 Wichtig:
Ein Moratorium ist eine aktive Entscheidung zur Selbstfindung – keine Kapitulation.
Selbsteliminierung hingegen ist meist ein unbewusster Rückzug, oft aus Angst, Überforderung oder fehlender Selbstwirksamkeit.
Fazit:
Das Moratorium bei Erikson ist ein bewusster „Pause-Knopf“, um Identität zu entwickeln – kein Rückzug ins Nichts.
Selbsteliminierung klingt wie eine metaphorische Schwester des Suizids.
Nicht zwangsläufig tödlich, aber radikal in der Wirkung:
„Ich bin raus – nicht weil ich scheitere, sondern weil ich mich selbst lösche.“
Wenn du damit arbeitest (z. B. essayistisch, künstlerisch oder analytisch), kannst du genau mit dieser Spannung spielen: zwischen sprachlicher Nähe zu Suizid und inhaltlicher Distanz davon. Das macht den Begriff so stark – und auch unbequem.
Selbsteliminierung bezeichnet allgemein den Vorgang, bei dem sich eine Person, Gruppe oder ein System selbst aus dem Spiel nimmt, sich also absichtlich oder unbeabsichtigt selbst entfernt, aufgibt oder zerstört. Der Begriff wird je nach Kontext unterschiedlich verwendet:
1. Politik / Gesellschaft
In politischen oder sozialen Kontexten kann Selbsteliminierung bedeuten:
- Eine Partei, Gruppe oder Person zieht sich freiwillig zurück (z. B. durch Rücktritt oder Aufgabe von Einfluss).
- Oder sie verhält sich so destruktiv oder widersprüchlich, dass sie ihre eigene Legitimität oder Position untergräbt (z. B. durch Skandale oder strategische Fehler).
Beispiel:
„Durch seine radikalen Aussagen hat sich der Politiker selbst eliminiert.“
2. Psychologie
Hier kann Selbsteliminierung bedeuten, dass sich jemand aus sozialen, beruflichen oder persönlichen Zusammenhängen selbst ausschließt, etwa durch:
- Selbstsabotage
- Vermeidung
- Resignation oder Rückzug
Beispiel:
„Sein ständiges Misstrauen führte zur Selbsteliminierung aus seinem Freundeskreis.“
3. Philosophie / Theorie
In theoretischen oder systemischen Zusammenhängen (z. B. bei Niklas Luhmann oder anderen Systemtheorien) beschreibt Selbsteliminierung oft:
- Ein System, das sich selbst durch interne Mechanismen abschafft oder handlungsunfähig wird.
4. Biologie / Technik / Fiktion
In technischen, biologischen oder fiktionalen Kontexten (z. B. bei Robotern, Aliens, Computersystemen) kann Selbsteliminierung konkret bedeuten:
- Selbstzerstörung (z. B. in Science-Fiction-Szenarien)
- Programmiertes Verschwinden
Fazit:
Selbsteliminierung bedeutet: jemand oder etwas entfernt sich selbst aus einem Prozess, einem System oder einer Gemeinschaft – durch eigenes Handeln, Versagen oder gezielte Aufgabe. Es kann freiwillig, unabsichtlich oder systembedingt sein.
In der Psychologie gibt es keinen einheitlichen Fachausdruck „Selbsteliminierung“, aber es gibt verwandte Fachbegriffe, die je nach Kontext präziser verwendet werden. Hier sind die wichtigsten:
🔹 1. Selbstsabotage
Fachbegriff: Self-sabotage
- Gemeint ist ein Verhalten, bei dem Menschen sich unbewusst oder bewusst selbst im Weg stehen, z. B. durch Aufschieben, Vermeiden, destruktives Verhalten.
- Ziel oder Folge ist oft ein Scheitern, obwohl Erfolg möglich wäre.
Beispiel:
Eine Studentin lernt absichtlich nicht genug vor Prüfungen, obwohl sie eigentlich bestehen will.
🔹 2. Autoaggressives Verhalten
Fachbegriff: Autoaggression
- Psychologisch bedeutet das: gegen sich selbst gerichtete Aggression, z. B. Selbstverletzung, selbstschädigendes Verhalten.
- Es kann Teil von psychischen Erkrankungen wie Depression, Borderline oder Angststörungen sein.
🔹 3. Selbstaufgabe
Fachbegriff: Self-abandonment oder Selbstverleugnung
- Der Mensch unterdrückt eigene Bedürfnisse, um Konflikte zu vermeiden, dazuzugehören oder zu „gefallen“.
- Kommt oft bei Menschen mit abhängiger Persönlichkeit oder in toxischen Beziehungen vor.
🔹 4. Erlernte Hilflosigkeit
Fachbegriff: Learned helplessness (Martin Seligman)
- Eine Person hat durch frühere Misserfolge „gelernt“, dass sie nichts bewirken kann, und gibt auf, obwohl Veränderung möglich wäre.
🔹 5. Dissoziation / Rückzug / Vermeidung
- In bestimmten Störungsbildern (z. B. Trauma, Depression) tritt psychischer Rückzug, soziale Isolation oder Vermeidung auf.
- Auch das kann man als eine Form von „Selbsteliminierung“ interpretieren.
Zusammenfassung
Es gibt keinen offiziellen Fachbegriff „Selbsteliminierung“ in der Psychologie, aber je nach Verhalten und Ursache verwendet man z. B.:
| Umgangssprachlich | Fachbegriff (Psychologie) |
|---|---|
| Selbst ausschließen / sabotieren | Selbstsabotage |
| Sich selbst schaden | Autoaggression |
| Sich selbst aufgeben | Selbstverleugnung, Selbstaufgabe |
| Aufgeben durch Misserfolgserwartung | Erlernte Hilflosigkeit |
| Rückzug aus dem sozialen Leben | Sozialer Rückzug, Vermeidung |
Wenn du mir deinen konkreten Kontext gibst (z. B. psychische Störung, Verhalten in Gruppen, Partnerschaft, etc.), kann ich dir den genau passenden Fachausdruck nennen.
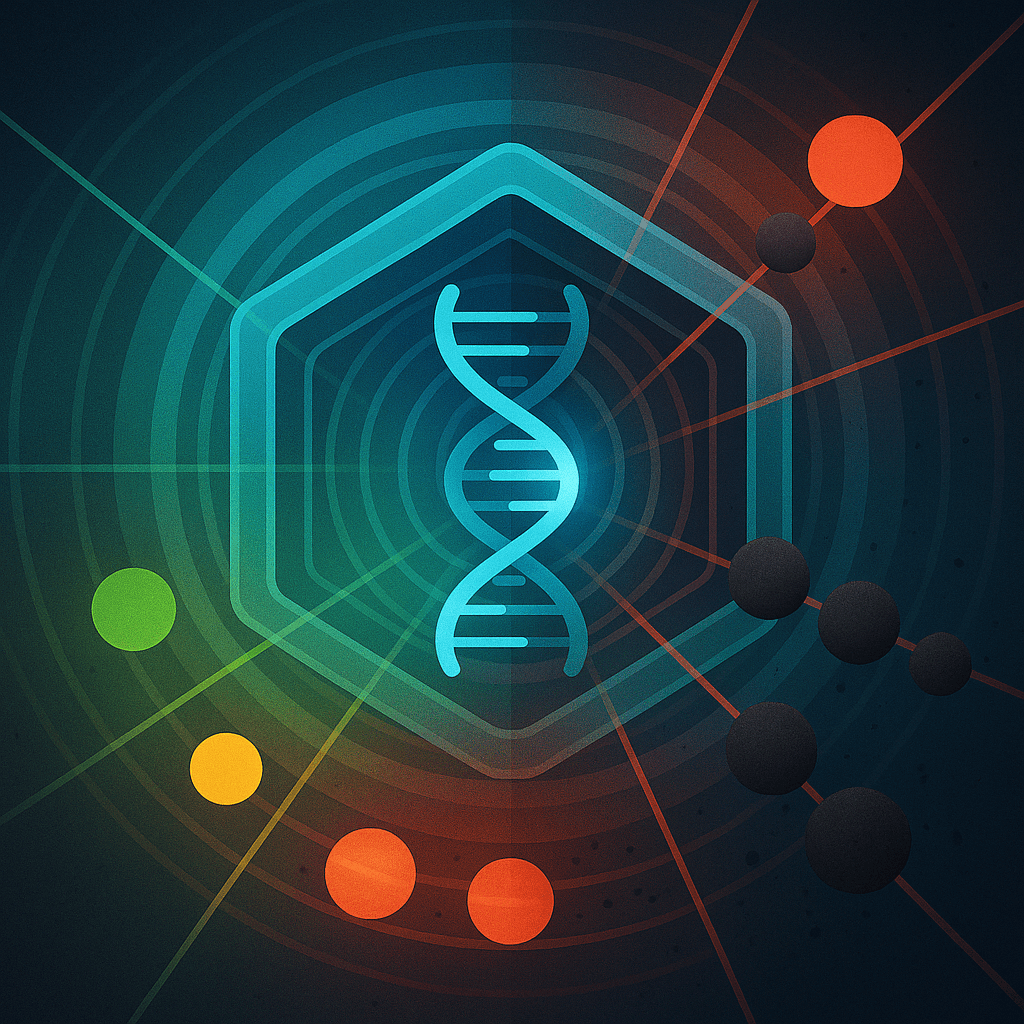
Angebote // Coaching
© 2025 epiCure | Alle Rechte vorbehalten. // © 2025 epiCure | all rights reserved.
Text, Bilder, Grafiken und Animationen auf diesen Seiten unterliegen dem Schutz des Urheberrechts.
Inhalte dieser Websites dürfen weder kopiert, verbreitet, verändert oder an Dritte zugänglich gemacht werden.
