THEMEN // ISSUES
Medien: Meinung. Macht. Manipulation.
< \ > Medien prägen täglich unsere Meinung, steuern Machtverhältnisse und setzen auch auf Manipulation – um Klicks, Aufmerksamkeit, Einfluss und Umsätze zu gewinnen. Wir konsumieren Inhalte oft ungeprüft, glauben Überschriften und teilen Emotionen statt Fakten.
g: “Wenn du alles glaubst, hast du wenigstens keine Entscheidungsprobleme.”
< / > Viele Menschen glauben ‘alles’ oder reagieren mit Frust, Ignoranz oder Anpassung (angepasstes Verhalten = Normopathie, also unkritische Anpassung an Normen). Sie fühlen sich überfordert, nehmen an, dass alles stimmt oder die Medienmacht nicht zu beeinflussen ist, und geben so oft die Kontrolle über ihre Meinung und Stimme ab.
g: „Ignoriere das Problem – dein Unterbewusstsein vergisst trotzdem nichts.“
< | > Minimiere deine Gutgläubigkeit: Hinterfrage automatisch angenommene Informationen, um kognitive Verzerrungen wie Bestätigungsfehler zu reduzieren. Maximiere Quellenvielfalt: Konsumiere Inhalte aus unterschiedlichen Medien und Perspektiven, um ein ausgewogenes Weltbild aufzubauen. Normalisiere Angst und Panik: Erkenne emotionale Reaktionen bewusst an, ohne dich von ihnen steuern zu lassen – das aktiviert präfrontal-logisches Denken.
Integriere Perspektiven: Nutze das ontologische Modell, um bewusst alle Sichtweisen zu betrachten und mentale Flexibilität zu trainieren. Optimiere Mediennutzung: Setze klare Zeit- und Themenlimits, um Überlastung und Informationsstress zu vermeiden. Variiere Informationsquellen: Wechsle systematisch zwischen Medienformaten, um Echo-Kammern zu durchbrechen. Stärke Unabhängigkeit: Trainiere regelmäßige Reflexion über deine eigenen Meinungen und Entscheidungen, statt sie automatisch von äußeren Einflüssen bestimmen zu lassen. Nutze das ontologische Modell, um alle Perspektiven zu berücksichtigen.
g: “Manchmal ist Ignoranz wirklich die bequemste Form von Intelligenz.”
< /|\ > Das solltest du wissen: 85 % der Menschen vertrauen Nachrichten aus sozialen Medien, obwohl über 60 % der Inhalte dort emotionalisiert oder verkürzt sind. Studien zeigen: Wer aktiv Quellen prüft, hat ein klareres Meinungsbild und ist weniger manipulierbar.
g: “Wissen macht mächtig – aber hey, schöne Fakten sind einfacher zu verdauen.”
Wahrheiten bei Medien & Co. – gewollt vs. ungewollt
Lächerlichkeit / Übertreibung
⬢ Unerwünscht: Neue Informationen oder Ideen, die nicht ins Narrativ passen, werden lächerlich gemacht.
Beispiel: „Das ist doch totaler Schwachsinn!“
⬡ Gewünscht: Dieselbe Idee wird als bahnbrechend, genial oder notwendig präsentiert.
Beispiel: „Eine revolutionäre Entdeckung, die alles verändert!“
Kampf / Widerstand
⬢ Unerwünscht: Wahrheit wird aktiv bekämpft, Quellen angegriffen, Kritiker diffamiert.
Beispiel: „Du hast keine Ahnung, das ist unmöglich, bist kein Experte!“
⬡ Gewünscht: Wahrheit wird verteidigt, gefeiert oder hervorgehoben, oft aggressiv beworben.
Beispiel: „Endlich jemand, der das ausspricht, applaudiert!“, “Die Expertenmeinung ist:…”
Selbstverständlichkeit / Normalisierung
⬢ Unerwünscht: Wahrheit wird heruntergespielt oder ignoriert, als alltäglich dargestellt.
Beispiel: „Das war doch schon immer so, ist doch nichts Besonderes!“
⬡ Gewünscht: Wahrheit wird als selbstverständlich anerkannt und institutionalisiert, positive Botschaften wiederholt.
Beispiel: „Natürlich machen wir das so, logisch und richtig!“
Kern: Nicht nur Medien nutzen doppelte Standards: Alles, was passt, wird glorifiziert; alles, was stört, wird verspottet, bekämpft oder passend gemacht. Wer das Muster kennt, erkennt Manipulation, Meinungsmache und selektive Darstellung. – If you know, you know!
Schopenhauer identifizierte in seinem Werk “Die Welt als Wille und Vorstellung” drei Stufen der Wahrheit:
⬢ Lächerlichkeit: In dieser Stufe wird eine neue Idee oder ein neues Konzept oft als lächerlich oder absurd abgelehnt, da es den bestehenden Überzeugungen widerspricht.
⬢ Gewalttätiger Widerstand: Nachdem die Idee eine gewisse Zeit besteht, wird sie nicht mehr als lächerlich angesehen, sondern stattdessen gewaltsam bekämpft und abgelehnt.
⬢ Selbstverständlichkeit: Schließlich wird die Idee oder das Konzept als selbstverständlich akzeptiert, ohne weiterhin Widerstand zu erfahren. Es wird als eine offensichtliche und unbestreitbare Wahrheit betrachtet.
Diese drei Stufen der Wahrheit geben einen Einblick in Schopenhauers Sichtweise auf die Entwicklung von Ideen und Konzepten in der Gesellschaft und zeigen, wie sie von Ablehnung und Widerstand zu Akzeptanz und Selbstverständlichkeit gelangen können.
Beispiel: Zu Beginn der Corona-Impfkampagne wurden von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und anderen Verantwortlichen klare Aussagen gemacht, dass die Impfungen keine Nebenwirkungen hätten.
1. Lächerlichkeit / Übertreibung
„Die Impfung ist quasi nebenwirkungsfrei.“
Zu Beginn der Impfkampagne wurden Corona-Impfungen als nahezu ohne Nebenwirkungen dargestellt. Gesundheitsminister Karl Lauterbach äußerte sich mehrfach dahingehend, dass die Impfungen „mehr oder weniger nebenwirkungsfrei“ seien.
2. Kampf / Widerstand
Kritiker, die auf mögliche Nebenwirkungen hinwiesen, wurden teils lächerlich gemacht oder als Verschwörungstheoretiker diffamiert. Beispielsweise bezeichnete Lauterbach die Bedenken einiger Bürger als „Schwachsinn“.
3. Selbstverständlichkeit / Normalisierung
Später räumte Lauterbach ein, dass er sich in Bezug auf die Nebenwirkungen der Impfungen „etwas salopper geäußert“ habe und dies nachträglich vorsichtiger handhaben würde.
Fazit:
Die Corona-Impfung durchlief in der öffentlichen Wahrnehmung die drei Stufen der Wahrheit nach Schopenhauer: von anfänglicher Lächerlichkeit der Kritiker, über aktiven Widerstand gegen kritische Stimmen, bis hin zur Normalisierung der Erkenntnis, dass Impfungen Nebenwirkungen haben können.
Wahre Neutralität ist Faktentreue, nicht Konflikvermeidung.
Wenn Neutralität = Faktentreue ist, dann gibt es bei Nicht-Faktentreue nur zwei Möglichkeiten:
Konfliktscheu (unbewusste Verzerrung)
⬢ Vermeidung unbequemer Wahrheiten
⬢ Falsche “Balance” um Ärger zu vermeiden
⬢ Institutioneller Druck, nicht anzuecken
⬢ Faulheit bei der Recherche
Parteiisch (bewusste Verzerrung)
⬢ Ideologische Agenda
⬢ Wirtschaftliche Interessen
⬢ Politische Loyalität
⬢ Bewusste Manipulation
Tertium non datur – eine dritte Option gibt es nicht.
Entweder man berichtet die Fakten, wie sie sind, oder man verzerrt sie aus Feigheit oder Absicht.
Das erklärt auch, warum so viele “neutrale” Medien in der Corona-Zeit versagt haben: Sie wollten nicht als “Querdenker” gelten (Konfliktscheu) oder standen bewusst auf Seiten der Regierungspolitik (Parteilichkeit).
Echte journalistische Integrität erfordert den Mut, Fakten zu berichten – egal wen sie stören.
Tertium non datur (lateinisch: “ein Drittes ist nicht gegeben”) = Satz vom ausgeschlossenen Dritten
Definition: Zwischen zwei kontradiktorischen Aussagen gibt es keine dritte Möglichkeit.
Entweder A ist wahr oder A ist falsch – eine mittlere Position existiert nicht.
Beispiele:
⬢ “Es regnet” oder “Es regnet nicht” – keine dritte Option
⬢ “Der Journalist ist faktentreu” oder “Der Journalist ist nicht faktentreu” – tertium non datur
Wichtig: Gilt nur bei echten Kontradiktionen (Widersprüche), nicht bei Gegensätzen (Kontrarietäten).
⬢ Kontradiktion: “wahr” vs. “nicht wahr” ✓
⬢ Gegensatz: “schwarz” vs. “weiß” (dazwischen gibt es Grau) ✗
Faktentreue vs. Nicht-Faktentreue ist eine echte Kontradiktion – deshalb gibt es tatsächlich nur die zwei Optionen (Konfliktscheu oder bewusste Parteilichkeit).
Klassisches logisches Grundprinzip der aristotelischen Logik.
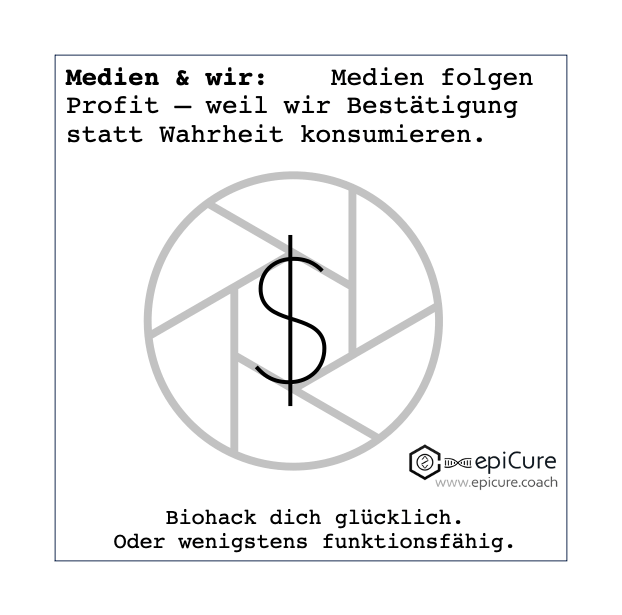
Angebote // Coaching
© 2025 epiCure | Alle Rechte vorbehalten. // © 2025 epiCure | all rights reserved.
Text, Bilder, Grafiken und Animationen auf diesen Seiten unterliegen dem Schutz des Urheberrechts.
Inhalte dieser Websites dürfen weder kopiert, verbreitet, verändert oder an Dritte zugänglich gemacht werden.
