THEMEN // ISSUES
Patriarch | Matriarchin: Wer formt, wer lenkt?
< \ > In vielen modernen Gesellschaften ist die natürliche Polarität zwischen männlicher und weiblicher Energie aus der Balance geraten. Während das Patriarchat einst für Überstruktur, Dominanz und Unterdrückung stand, zeigt sich heute oft eine matriarchale Dynamik, in der emotionale Kontrolle, diffuse Rollenbilder und Grenzenlosigkeit den Ton angeben. Das Problem liegt nicht in einem Geschlecht, sondern im Verlust der gesunden Gegenspannung: Das Männliche wird abgewertet, das Weibliche überdehnt. Ergebnis: toxische Ausdrucksformen auf beiden Seiten.
g: “Früher herrschte der Patriarch mit der Faust – heute regiert die Matriarchin mit dem Gefühlskalender.”
g: “Er sagt nichts mehr, sie fühlt alles – aber keiner weiß, wohin’s geht.”
< / > Die übliche Reaktion auf dieses Ungleichgewicht ist Verunsicherung, Rückzug oder ideologische Aufladung. Männer fühlen sich oft orientierungslos oder entwertet, Frauen wiederum überfordert oder unerfüllt, obwohl sie scheinbar alles dürfen. Statt bewusster Auseinandersetzung entstehen Abwehrhaltungen: entweder eine Rückkehr zur alten Autorität (Patriarchat 2.0, Tredwife und weitere Trends*) oder eine uneingeschränkte Selbstausdehnung (Matriarchale Totalfreiheit). Beide Reaktionen verschärfen das Problem – sie sind reaktiv statt gestaltend.
g: “Wenn keiner mehr führt, führen irgendwann die unausgesprochenen Erwartungen.”
g: “Gleichberechtigung ist super – bis keiner mehr den Müll rausbringt.”
g: “Man kann nicht gleichzeitig Richtung geben und alle immer verstehen wollen.”
< | > Was es braucht, ist eine bewusste Neuausrichtung der Polarität:
⬡ Das Männliche soll nicht dominieren, sondern strukturieren (normalisieren).
⬡ Das Weibliche soll nicht kontrollieren, sondern verbinden (integrieren).
⬡ Beide Kräfte müssen erkennbar gemacht (detektieren), ausbalanciert (optimieren) und in Wechselwirkung gebracht werden (variieren).
Eine gesunde Gesellschaft entsteht durch Spannung, nicht durch Gleichmacherei. Der Schlüssel liegt in der Anerkennung von Unterschiedlichkeit – nicht im Kampf gegen sie.
g: “Bevor du weiter streitest: Lies das hier.”
g: “Zwischen Instagram-Feminismus und Podcast-Maskulinität passt noch ein bisschen Realität.”
< /|\ > Das solltest du wissen: Die Begriffe „toxisch“ oder „patriarchal“ sind heute oft ideologisch aufgeladen – ursprünglich jedoch beschreiben sie energetische Zustände, keine Schuldzuweisungen.
⬡ „Toxisch“ bedeutet: Eine Kraft wirkt außerhalb ihres natürlichen Rahmens.
⬡ „Patriarch“ kommt vom griechischen patriarchēs: Vaterherr, nicht Tyrann.
⬡ „Matriarchin“ bedeutet ursprünglich: Mutter als Zentrum – nicht als Regentin.
Wichtig: Polarität ist kein Problem – sie ist ein Prinzip der Natur. Probleme entstehen nur, wenn ein Pol fehlt, entwertet oder überbetont wird.
*Verwandte Trends im “Patriarchat 2.0”
“Tradwife” (traditional wife) ist ein Social-Media-Trend, bei dem meist junge Frauen ein traditionelles Hausfrauendasein romantisieren – mit Backen, Putzen, Kindererziehung und kompletter finanzieller Abhängigkeit vom Ehemann. Sie inszenieren dies ästhetisch ansprechend auf Instagram und TikTok.
Manosphere-Bewegungen: “Alpha Male”-Mentalität, Pick-up-Artists, MGTOW (Men Going Their Own Way) – oft mit extremen Geschlechterrollenvorstellungen.
“Soft Girl” vs. “Boss Babe”: Gegenreaktion zu feministischen Erfolgsidealen, Sehnsucht nach traditioneller Weiblichkeit und männlichem Schutz.
Religiöse Revitalisierung: Besonders in evangelikalen Kreisen wird traditionelle Ehe und Familie als Gegenentwurf zur modernen Gesellschaft propagiert.
Anti-Feminismus 2.0: Verpackt als “Wahlfreiheit” oder “natürliche Ordnung”, aber mit klaren patriarchalen Strukturen.
Red Pill/Black Pill-Ideologien: Extreme Online-Subkulturen mit frauenfeindlichen Weltanschauungen.
Das Paradoxe: Diese Trends nutzen moderne Plattformen und Marketing, um anti-moderne Botschaften zu verbreiten. Oft stecken dahinter auch ökonomische Interessen – Tradwife-Influencerinnen monetarisieren ihre “Einfachheit” durchaus geschickt.
Toxische Männlichkeit: Wenn Stärke zur Trennung wird
Während “toxische Männlichkeit” ein etablierter Begriff geworden ist, gibt es tatsächlich weniger Diskussion über problematische Verhaltensmuster, die manchmal mit weiblicher Sozialisation verbunden werden.
Toxische Männlichkeit beschreibt ja schädliche Aspekte traditioneller Männlichkeitsvorstellungen – wie emotionale Unterdrückung, Aggressivität als einziger Ausdruck von Stärke, oder die Abwertung von allem “Weiblichen”.
Toxische Weiblichkeit: Wenn Fürsorge zur Kontrolle wird
Bei Frauen können sich problematische Muster anders zeigen: chronische Unzufriedenheit, passive Aggressivität, übermäßige Kritik (besonders an anderen Frauen), oder die Verwendung emotionaler Manipulation. Manche Forscherinnen sprechen von “toxischer Weiblichkeit” – etwa wenn Frauen andere Frauen wegen ihrer Entscheidungen verurteilen oder wenn Konkurrenzdenken zu destruktivem Verhalten führt.
Der wichtige Punkt ist: Diese Muster entstehen oft durch gesellschaftliche Erwartungen und Einschränkungen. Frauen wurde historisch oft verwehrt, Macht direkt auszuüben, was zu indirekteren Formen der Einflussnahme führen konnte. Genau wie bei Männern sind diese Verhaltensweisen Produkte gesellschaftlicher Strukturen, nicht inhärente Eigenschaften.
⬢ Polarität & Grenze – Eine Betrachtung jenseits von Schuld
Jenseits von ideologischer Debatte oder moralischer Bewertung wirken in Menschen – ob Mann oder Frau – tiefe, evolutionär gewachsene Energien. Sie sind nicht gut oder böse, sondern funktional. Doch in modernen, oft grenzverlorenen Gesellschaften geraten diese Kräfte leicht aus dem Gleichgewicht.
⚪ Die weibliche Grundtendenz:
Das weibliche Prinzip strebt danach, Sicherheit für sich und die Nachkommen zu schaffen.
Evolutionsbiologisch gesehen bedeutet das:
⬡ Schutz,
⬡ emotionale Bindung,
⬡ Kontrolle über das soziale Umfeld.
Diese Energie zeigt sich heute oft als:
⬡ Bedürfnis nach Absicherung (emotional, materiell, sozial),
⬡ subtile Lenkung von Beziehungen,
⬡ Orientierung an höherem Status (Hypergamie),
⬡ Suche nach emotionaler Erfüllung und Resonanz.
Im Extrem (wenn keine gesunde Grenze gesetzt ist), kann diese Energie kippen in:
⬢ chronische Unzufriedenheit,
⬢ passiv-aggressives Verhalten,
⬢ Kontrolle durch Emotionalität oder Schuldgefühle,
⬢ narzisstische Selbstdrehung unter dem Deckmantel von „Authentizität“.
⚫ Die männliche Grundtendenz:
Das männliche Prinzip zielt evolutionär auf:
⬡ Richtung geben,
⬡ Raum schaffen,
⬡ Grenzsetzung und Schutz.
Diese Energie zeigt sich u. a. als:
⬡ Bedürfnis nach Klarheit, Struktur, Wettbewerb,
⬡ rationales Handeln,
⬡ Führungsverantwortung.
Im Extrem, wenn sie nicht bewusst integriert ist, kann sie kippen in:
⬢ emotionale Abspaltung,
⬢ Dominanzdenken,
⬢ Abwertung des Weiblichen,
⬢ autoritäres Kontrollverhalten.
Was fehlt heute?
Nicht „die Frau“ oder „der Mann“ ist das Problem – sondern das Fehlen der balancierenden Gegenspannung. Wenn männliche Grenzsetzung verteufelt und weibliche Bedürfnisdynamik idealisiert wird, entsteht ein System, in dem grenzenlose Energie toxisch wirkt – in beide Richtungen.
Grenzen sind kein Zwang – sie sind Durchlässigkeit mit Bewusstsein.
Polarität ist kein Machtkampf – sie ist Spannung, die Leben erzeugt.
Die Einladung
Statt Schuld zu suchen, lohnt es sich, Muster zu erkennen:
⬡ Welche Energie ist dominant?
⬡ Wo fehlt der Gegenpol?
⬡ Wie kann man aus unbewussten Trieben bewusste Gestaltung machen?
Gleichberechtigung ≠ Ergebnisgleichheit
Gleichberechtigung = Gleiche Chancen, gleiche Rechte, gleiche Ausgangsbedingungen
⬢ Jeder bekommt die gleiche Startlinie
Ergebnisgleichheit = Gleiche Resultate, unabhängig von Leistung, Entscheidungen oder Umständen
⬢ Jeder kommt gleichzeitig ins Ziel an
Beispiel:
⬢ Gleichberechtigung: Alle dürfen studieren, sich bewerben, Unternehmen gründen
⬢ Ergebnisgleichheit: Alle müssen das gleiche Gehalt haben, egal was sie tun
Gleichberechtigung respektiert individuelle Unterschiede, Entscheidungen und Anstrengungen. Ergebnisgleichheit ignoriert sie.
Die Verwechslung dieser beiden Konzepte führt oft zu politischen und gesellschaftlichen Spannungen – weil das eine Fairness fördert, das andere sie oft untergräbt.
Nicht das Männliche oder Weibliche ist toxisch –
…sondern das Ungleichgewicht, wenn einer der Pole entgrenzt wirkt – ohne gesunde, bewusste Antwort des anderen.
“Neusprech gendert alles – nur bei Vergewaltiger:innen macht es plötzlich eine Ausnahme. Als ob selbst die Sprache wüsste: Hier ist Gleichberechtigung fehl am Platz.”
//
“Neusprech gendert Bäcker:innen, Lehrer:innen, Arbeiter:innen – nur nicht Vergewaltiger. Selbst die Grammatik hat noch einen Instinkt für das Böse.”
Tatsächlich ist die Beobachtung nicht ganz korrekt. Die Suchergebnisse zeigen ein differenzierteres Bild:
Ein Sternchen in „Vergewaltiger*innen” sollte unterbleiben. Dieses Verbrechen ist überwiegend eine Gewalttat von Männern an Frauen. Augen auf bei den Geschlechterrollen: Täter und Täterinnen – Textlabor von genderleicht.de – so rät genderleicht.de aus sachlichen Gründen davon ab.
Andererseits wird “Täter und Täterinnen” statt “Täterinnen und Täter” oder “Täter:innen” Gendergerechte, diskriminierungsfreie und inklusive Sprache: beauftragte-missbrauch.de von offiziellen Stellen durchaus verwendet, und wenn es allgemein um Täter*innen oder so geht, dann sollte das Wort natürlich gegendert werden – wenn denn im Rest des Textes auch gegendert wird. Warum wird bei “Täter”, “Vergewaltiger”, “Mörder” usw. nicht gegendert? (Frauen, Männer, Sprache)
Die Realität ist also nuancierter: Bei konkreten Gewaltverbrechen wie Vergewaltigung wird oft auf das Gendern verzichtet, weil es statistisch überwiegend männliche Täter sind. Bei allgemeinen Begriffen wie “Täter” wird hingegen durchaus gegendert. Es ist also nicht so simpel, wie der Vergleich suggeriert.
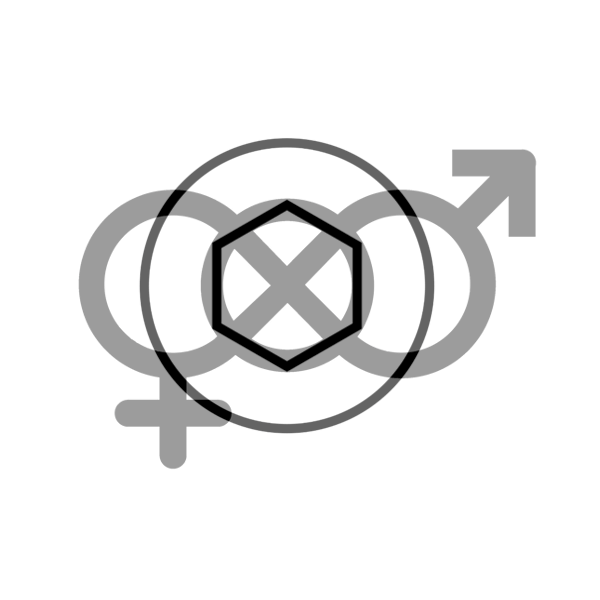
Angebote // Coaching
© 2025 epiCure | Alle Rechte vorbehalten. // © 2025 epiCure | all rights reserved.
Text, Bilder, Grafiken und Animationen auf diesen Seiten unterliegen dem Schutz des Urheberrechts.
Inhalte dieser Websites dürfen weder kopiert, verbreitet, verändert oder an Dritte zugänglich gemacht werden.
